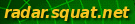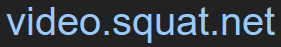| Werthebach, Eckart |
Hier einige Infos aus dem Munzinger Archiv, leider gehen die Infos nur bis 1997
deutscher Jurist; Staatssekretär im Bundesinnenministerium
Geburtstag: 17. Februar 1940 in Essen
Eckart Werthebach wurde am 17. Febr. 1940 in Essen geboren. Nach der Gymnasialzeit in Betzdorf studierte er Rechtswissenschaften in Würzburg. 1966 und 1971 machte er die juristischen Staatsprüfungen, 1969 promovierte er mit einem verfassungsrechtlichen Thema zum Dr. jur. utr.
Zwei Monate (1.5.-30.6.) war W. 1971 Beamter bei der Bezirksregierung Unterfranken, ehe er am 1. Juli 1971 Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums wurde. Seither hat er, der sich ein “Ziehkind des Bundesinnenministeriums” nennt, Karriere ausschließlich “im Hause” gemacht. Er durchlief die Ministerialabteilungen für Dienstrecht und für Verfassungsrecht und wurde 1976 persönlicher Referent des damaligen Staatssekretärs Fröhlich. Seither war er auf dem Feld der Inneren Sicherheit tätig, zunächst betraut mit der Fachaufsicht über das Bundeskriminalamt – hier machte er sich in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität verdient – dann über das Bundesamt für Verfassungsschutz (seit 1981). W. war 1977 Mitglied der Krisenstäbe nach der Ermordung von Generalbundesanwalt Buback, dem Dresdner-Bank-Chef Ponto und nach der Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Schleyer. Diese Zeit, “in der wir tatsächlich im Ministerium übernachtet haben”, habe ihn, so sagt er, entscheidend geprägt (SZ, 4.3.1991).
Ständiger Vertreter des Abteilungsleiters für Innere Sicherheit war der parteilose, dennoch der CDU zugerechnete Jurist, den die Süddeutsche Zeitung (4.3.1991) in der Truppe der Bonner Ministerialen “zur kleinen Garde der Manager-Begabungen” rechnet, seit 16. Mai 1988. Maßgeblich war er an der Entstehung des neuen Verfassungsschutzgesetzes beteiligt, das seit 1990 in Kraft ist. Zu Zeiten der Regierung de Maizière in der früheren DDR (März-Okt. 1990) war er als Berater in der DDR-Regierungskommission zur Auflösung des Staatssicherheitsdienstes. Präsident des Kölner Bundesamtes für Verfassungsschutz war W. seit 28. Febr. 1991. Am 20.2.1991 war er vom Bundeskabinett zum Nachfolger von Gerhard Boeden ernannt worden. Der “reine Binnenwechsel” war ohne parteipolitische Rangeleien zustande gekommen. Die Erwartungen, die an den obersten Verfassungsschützer gerichtet sind, formulierte Bundesinnenminister Schäuble bei dem Festakt zur Verabschiedung von Boeden: Ein wesentlicher Teil der Arbeit des neuen Präsidenten sollte darin bestehen, die Aufgaben zu lösen, die sich “aus dem Beitritt der DDR ergeben”. Das galt vor allem für die Ausdehnung seines Amtes auf die neuen Bundesländer.
Spezifische Aufgaben in den neuen Bundesländern zeichneten sich bald ab. Nach den Kölner Beobachtungen gab es dort, jedenfalls bei militanten Rechtsextremisten, eine gefährliche Bereitschaft zur Gewalt. Die PDS war bei alledem nicht im Visier. Ihr Reformabsichten von vorneherein abzuerkennen, war W.s Sache nicht (ZEIT, 22.3.1991). W. befürwortete eine Amnestie für Agentenführer und Spione der früheren DDR-Staatssicherheit und wollte diese aber ausdrücklich auf den Kreis der Mitarbeiter der früheren Hauptverwaltung Aufklärung eingegrenzt wissen. Andere Verbrechen der Staatssicherheit sollten nicht amnestiert werden.
Zurückhaltend äußerte sich W. zunächst zu Überlegungen, ob der Verfassungsschutz nicht auch bei der Überwachung desWaffenexportes oder der Bekämpfung der organisierten Kriminalität von Nutzen sein könne. Ende 1992 forderte er dann erweiterte Befugnisse für seine Behörde, um letztere im Vorfeld beobachten zu können (FAZ, 30.10.1992), konnte sich damit jedoch nicht durchsetzen. “Große Sorgen” machte ihm nach eigenem Bekunden der nationale Terrorismus, von links wie insbesondere von rechts. Hier plädierte er für “politische Lösungen” (FAZ, 8.2.1992). Im Frühjahr 1995 beklagte er die zunehmende Gewalt von ausländischen extremistischen Gruppierungen. Er benannte als Gefahrenherd vor allem die in Deutschland verbotene kurdische PKK und mehrere islamistische Organisationen (Welt, 17.3.1995).
Während seiner Dienstzeit wurde das Bundesamt für Verfassungsschutz wiederholt wegen Unstimmigkeiten bzw. Kompetenzüberschreitungen kritisiert. Im Nov. 1991 soll seine Behörde einen Mitarbeiter des niedersächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz kontaktiert haben (Welt, 21.8.1992), und ein Jahr später warf ihr DER SPIEGEL (6.4.1992) eine beliebige Auslegung der Datenschutzgesetze vor. Dennoch war W. als solider und zuverlässiger Leiter des BfV anerkannt. Ende 1994 wurde W. daher als möglicher Nachfolger des BND-Präsidenten Konrad Porzner (SPD) genannt.
Am 25.4.1995 befürwortete das Bundeskabinett die Berufung von W. zum Staatssekretär im Innenministerium. Er trat am 1.6.1995 die Nachfolge des ausscheidenden Staatssekretärs Franz Kroppenstedt an. Vorrangige Aufgabe sollte zunächst die Reform des öffentlichen Dienstes sein. Für diese Position war W. bereits im Juli 1993 im Gespräch. Damals scheiterte die Kandidatur wegen des Vorwurfs der illegalen Weitergabe von Verfassungsschutzakten zuungunsten von Thilo Weichert (GRÜNE). Dieser glaubte dadurch die Wahl zum brandenburgischen Datenschutzbeauftragten im Jahr 1991 verloren zu haben. Mitte 1995 wurde das Ermittlungsverfahren in dieser Sache, das im Okt. 1994 eingestellt worden war, nach dem Auftauchen weiterer Unterlagen durch die Kölner Staatsanwaltschaft erneut aufgenommen.
Mitgliedschaften/Ämter u. a.: Seit Nov. 1988 ist W. stellv. Vorsitzender des Kuratoriums der Schule für Verfassungsschutz.
W. ist seit 1965 mit der Juristin Eva, geb. Durlak, verheiratet. Sie haben eine Tochter.
Bundesministerium des Inneren, Graurheindorfer Str. 198, 53117 Bonn; Tel.: 0228/6 81-1, -52 03