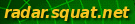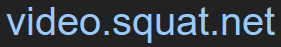Zwischen gesellschaftlicher Intervention und radikaler Nischenpolitik.
Hausbesetzungsbewegungen gehörten zu den wichtigsten sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre. Ob in Amsterdam, Mailand, Paris, Berlin, Barcelona, London, Kopenhagen oder Zürich – in vielen westeuropäischen Großstädten waren besetzte Häuser und soziale Zentren Knotenpunkte im weiten Netz der sozialen und politischen Bewegungen. Hausbesetzungen waren zwar keine Erfindung dieser Zeit. In der jahrhundertealten Geschichte von städtischen Kämpfen und Armutsbewegungen spielte die Aneignung von Land und Wohnraum immer eine zentrale Rolle. Spätestens in den 1970er Jahren traten aber Besetzungen eines neuen Typs auf, in denen die Aneignung von Räumen verbunden war mit einer darüber hinaus gehenden politischen Mobilisierung und Intervention, mit dem Herstellen von Öffentlichkeit und politischen Bündnissen, der Formulierung von Forderungen und dem Versuch, diese mittels der Besetzung und anderer Aktionen durchzusetzen.
Mit den sogenannten Zürcher Opernhauskrawallen im Mai 1980 und der von ihnen angestoßenen Welle spontaner Jugendrevolten in zahlreichen westeuropäischen Städten weiteten sich die Hausbesetzungsbewegungen insgesamt, wenn auch nicht überall gleichermaßen, aus.(1) Die entscheidenden Veränderungen, die sich auch in ihrem Selbstverständnis und ihren politischen Zielen niederschlugen, gingen aber auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zurück, in denen sie sich bewegten. Die 1980er Jahre waren in fast allen westlichen Ländern eine Zeit des politischen Umbruchs. Die weltweite Wirtschaftskrise von 1973/74 hatte den ökonomischen Aufschwung der Nachkriegszeit endgültig beendet. Die sozialdemokratischen Hegemonie und damit eine gesellschaftlichen Ordnung, die auf dem Wohlstandsversprechen des männlichen Normalarbeitsmodells und des Massenkonsums, der Ausdehnung des Wohlfahrtsstaats und einer damit verbundenen Bürokratisierung weiter Lebensbereiche sowie der korporatistischen Einbindung von Unternehmen und Gewerkschaften beruhte, wurde an allen Enden brüchig.
Auf der stadtpolitischen Ebene verlor das Modell der funktional aufgeteilten Stadt und des zentralstaatlich-autoritären Modus ihrer Durchsetzung massiv an Akzeptanz – und die aufkommenden städtischen Bewegungen, darunter die Hausbesetzungsbewegungen, waren daran wesentlich beteiligt. Die Wahlsiege Margaret Thatchers in Großbritannien (1979) und Ronald Reagans in den USA (1981) markierten den Auftakt für die Etablierung einer neuen, neoliberalen Hegemonie, die sich in Form von Privatisierungen, staatlichem Rückzug aus der Stadterneuerung und der kommunalen Daseinsvorsorge sowie der Ausrichtung am globalisierten Standortwettbewerb auch auf der städtischen Ebene niederschlug.
Dieser Umbruch zwischen einer krisenhaften fordistischen gesellschaftlichen Ordnung und einer aufkommenden, aber noch keinesfalls hegemonialen Neoliberalisierung ist der Kontext, in dem sich die städtischen Kämpfe und darunter die Hausbesetzungsbewegungen der 1980er Jahre entfalteten – und der ihre Besonderheit gegenüber vorherigen und nachfolgenden Kämpfen ausmacht. (2) Am Beispiel der Ende der 1970er bzw. Mitte der 1980er Jahre entstandenen Besetzungsbewegungen in Berlin (I.) und Barcelona (II.) und ihres Einflusses auf die Durchsetzung eines neuen stadtpolitischen Modells möchte ich zeigen, dass ihre Erfolge und ihre Niederlagen vor diesem Hintergrund verstehbar werden (III.): Die Berliner Hausbesetzungsbewegung intervenierte an der Bruchstelle zwischen fordistischer und neoliberaler Stadterneuerung und konnte dabei wichtige Forderungen der städtischen Bewegungen durchsetzen. Dagegen entwickelte sich das movimiento okupa Barcelonas, das in seinen Forderungen, seiner Praxis und seinem Selbstverständnis ebenso in den spätfordistischen Kämpfen verwurzelt war, unter den Bedingungen einer bereits stattfindenden Neoliberalisierung der Stadtpolitik. Ihm fehlten so die Ansatzpunkte, über eine – wenn auch erfolgreiche – »radikale Nischenpolitik« hinaus wirksam in die Stadtpolitik einzugreifen.
I.
In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1980 »brannte« Berlin, so wie knapp sieben Monate zuvor Zürich »gebrannt« hatte. Im Anschluss an die schnelle Räumung eines frisch besetzten Hauses am Fraenkelufer 48 im Bezirk Kreuzberg entzündeten sich Straßenschlachten, wie die Stadt sie seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hatte.(3) Am frühen Abend, kurz nach der Räumung, hatten sich mehr als 100 Menschen auf der Straße versammelt. Als sich das Gerücht verbreitete, die Polizei würde versuchen, andere besetzte Häuser am Fraenkelufer oder in der benachbarten Admiralstraße zu räumen, wurden Barrikaden gebaut. Am Kottbusser Tor flogen Steine auf die anrückende Verstärkung – der Startschuss für Auseinandersetzungen, die bis zum frühen Morgen andauerten.
Die sogenannte – und oft verklärte – »Schlacht am Fraenkelufer« ist in vielerlei Hinsicht ein Wendepunkt in der Geschichte der städtischen Bewegungen in Berlin. Gleichwohl kam sie nicht aus dem Nichts. Bereits seit Mitte der 1970er Jahre hatte der Protest gegen die Stadt-, insbesondere gegen die Wohnungspolitik des Berliner Senats zugenommen. Nicht nur in Kreuzberg, auch in Schöneberg, Wedding oder Charlottenburg begannen sich Stadtteilinitiativen gegen die andauernde Wohnungsnot und die städtische Lösungsstrategie der »Kahlschlagsanierung« zu wehren: Seit den 1960er Jahren wurden ganze Straßenzüge mit verfallenden Wohnkasernen aus der Gründerzeit mit staatlichen Mitteln aufgekauft, abgerissen und mit »Sozialwohnungen« neu bebaut.(4) Die Wohnungsnot löste diese Strategie nicht. »Sozialwohnungen« waren deutlich teurer als es instandgesetzte Altbauten gewesen wären, so dass sie für einen Großteil der Wohnungssuchenden nicht erschwinglich waren. Und das Ausrufen von großflächigen Sanierungsgebieten befeuerte die Immobilienspekulation. Investor_innen kauften Häuser auf, entmieteten sie und ließen sie verfallen, um so kräftig zulasten der öffentlichen Hand zu verdienen.(5) Darüber hinaus kritisierten Stadtteilgruppen die Zerstörung nicht nur baulicher, sondern auch gewachsener sozialer Strukturen. Statt einer autoritären Planung von oben, die sich am Leitbild der autogerechten, verwaltbaren und ökonomisch-funktionalen Stadt orientierte, forderten sie eine dezentrale, demokratische und gebrauchswertorientierte Stadt- und Wohnungspolitik.(6)
Doch obwohl schon Mitte der 1970er Jahre in oppositionellen Planer_innen-Kreisen ein Umdenken begann und auch schon erste Modellprojekte einer »behutsamen« Planung stattfanden,(7) bissen sich die Stadtteilgruppen an der Senatspolitik die Zähne aus. Ungeachtet immer größerer und häufigerer Proteste blieb der Senat seiner Linie treu. Angesichts der Aussichtslosigkeit, mittels öffentlicher Proteste und Dialoge mit den Verantwortlichen eine Änderung dieser Politik zu erreichen, begannen sich die Proteste auch in spontanen Sachbeschädigungen und ersten Besetzungen zu entladen.(8) Die Bürger_innen-Initiative (BI) SO 36, benannt nach dem entsprechenden Postbezirk im Osten Kreuzbergs, war die erste Stadtteilgruppe, die systematisch zum Mittel des zivilen Ungehorsams griff: Im Februar organisierte sie die ersten »Instandbesetzungen«. In zwei Wohnungen in der Görlitzer Str. 74 und der Lübbener Str. 3 fingen die Besetzer_innen sofort mit Instandsetzungsarbeiten an, um so auf die spekulationsgetriebene Wohnungsnot und den baulichen Verfall aufmerksam zu machen und gleichzeitig ihre Akzeptanz gegenüber der Nachbarschaft und der städtischen Öffentlichkeit zu erhöhen. Die Strategie war erfolgreich, die betroffene Wohnungsbaugesellschaft versprach, 42 Wohnungen instandzusetzen und neuen Mieter_innen zur Verfügung zu stellen. Das Modell machte Schule, und schon bald griffen nicht nur Stadtteilinitiativen zum Mittel der Besetzung. Vor allem Menschen aus der Alternativbewegung, die nach Räumen für andere Formen des Arbeitens und Zusammenlebens suchten, sahen hier ihre Chance. Bis zu jenem Dezember 1980 waren so bereits 21 Häuser besetzt.(9)
Die zeitliche Nähe zu den Züricher Opernhauskrawallen war kein Zufall. Denn die anbrechende »Revolte ‘81«10 wurde nicht nur von der studentisch geprägten Alternativbewegung und der heterogeneren Stadtteilbewegung getragen. In die erste große Berliner Hausbesetzungsbewegung (11) floss noch eine dritte Strömung mit ein. Wie in Zürich, in Freiburg, Bremen, später Amsterdam oder auch London war es eine neue Jugendbewegung, die ihrer Wut, Frustration und Perspektivlosigkeit Ausdruck verschaffte, aber auch ihrer Forderung nach selbstbestimmten Räumen für Lebensweisen, die von der bürgerlichen Norm abwichen. Die Jugendlichen waren die gesellschaftliche Gruppe, die ab Ende der 1970er Jahre die Folgen der Wirtschaftskrise am deutlichsten zu spüren bekamen: steigende Arbeitslosigkeit, das Fehlen von Ausbildungsplätzen sowie die Kürzung kommunaler Mittel v. a. in den Bereichen Bildung, Jugendförderung, öffentliche Infrastruktur. Das Gefühl gesellschaftlicher und politischer Enge wurde verstärkt vom Umschlagen einer gesellschaftlichen Liberalisierung in der Zeit der sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt (1969–1974) in Repression und Regression unter seinem Nachfolger Helmut Schmidt (1974–1982). Zur schwindenden Aussicht auf einen ausreichenden Lebensunterhalt und auf individuelle Erfüllung in (Aus)Bildung und Lohnarbeit trat die gemachte kollektive Erfahrung einer Pluralisierung der Lebensentwürfe, die nun an Grenzen stieß. Insbesondere die Jugendkultur differenzierte sich in eine Vielzahl von Subkulturen aus, die von den bürgerlichen Normen abwichen und die nun angesichts der zunehmenden Anforderungen an Anpassungs- und Leistungsbereitschaft, aber auch der fehlenden Orte, an den gesellschaftlichen Rand rückten.
In ihrer Wahrnehmung, innerhalb der politischen Institutionen und im Dialog mit den politisch Verantwortlichen keine Veränderungen durchsetzen zu können, traf sich die neue Jugendbewegung sowohl mit der Stadtteilbewegung (siehe oben) als auch mit der Alternativbewegung. Letztere formierte sich aus der Erfahrung gescheiterter gesellschaftlicher Interventionsversuche in den 1970er Jahren. Der Berliner TUNIX-Kongress 1978 gab den Startschuss zum Rückzug aus der Mehrheitsgesellschaft und zum Aufbau konkreter Projekte alternativer Ökonomien und kollektiver Lebensweisen.(12)
Mit der Stadtteil-, der Alternativ- und der Jugendbewegung kamen so drei, in Zusammensetzung, Aktionsformen und Zielen unterschiedliche Bewegungsströmungen zusammen. Aus ihnen gingen unterschiedliche Typen der Hausbesetzung hervor.(13) Die ersten Instandbesetzungen waren klassische Fälle einer erhaltenden (conservational) Besetzung. Die wohnungs- und mietpolitischen Initiativen sahen in den Besetzungen ein Mittel, die Zerstörung der baulichen und sozialen Strukturen zu verhindern und eine andere Form der Stadterneuerung durchzusetzen. Menschen aus der Alternativbewegung suchten mittels der Besetzungen Räume für neue Wohnformen (squatting as an alternative housing strategy) sowie für Betriebe der alternativen Ökonomie und Kultur (entrepreneurial squatting) zu finden. Für viele Jugendliche ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz waren Besetzungen eine Möglichkeit, überhaupt eine Wohnung außerhalb ihres Elternhauses zu finden, was als Fall von Besetzungen aus der Not heraus gelten kann (deprivational squatting). Und schließlich betrachteten Aktivist_innen aus der radikalen Linken bzw. der entstehenden autonomen Bewegung die Häuser als politischen Einsatz, als Mittel im Kampf für einen gesellschaftlichen Wandel (political squatting). Die Vielfalt der Besetzungen und die Breite der Bewegungsströmungen waren eine erste Bedingung für den Erfolg der Berliner Hausbesetzungsbewegung. Und zunächst spielten die Konflikte, die sich zwischen ihnen entwickelten, auch kaum eine Rolle. Im Gegenteil: Die wohnungspolitisch motivierten, eher symbolisch gemeinten Besetzungen waren unmittelbar erfolgreich auch wegen des Konfliktniveaus, das von radikaleren Gruppen errichtet wurde. Und diese profitierten wiederum von der politischen »Gärungsarbeit«, die zuvor die institutionen- und verhandlungsorientierte Stadtteilbewegung geleistet hatte.
Eine zweite Bedingung war eben jener gesellschaftliche Bruch, der sich in den beschriebenen, schon länger sichtbaren Rissen der fordistischen Stadtpolitik andeutete. Die »Schlacht am Fraenkelufer« war auch hier der Wendepunkt. In ihr kulminierten die langjährigen stadtpolitischen Proteste, welche die Akzeptanz der Sanierungspolitik und der zentralistisch-autoritären Verwaltung der Stadt nachhaltig untergraben und dagegen ihre Vision des städtischen Lebens gesetzt hatten. Diese Eskalation brachte den darüber hinaus durch einen Korruptionsskandal um den Bauunternehmer Garski geschwächten Senat unter dem Regierenden Bürgermeister Stobbe (SPD) zu Fall, der Anfang Januar 1981 einem Übergangssenat unter seinem Parteikollegen Hans-Jochen Vogel Platz machte. Dieser Anfang vom Ende der langjährigen sozialdemokratischen Regierung der Stadt läutete auch einen stadtpolitischen Kurswechsel ein. Zunächst nutzten jedoch die Besetzer_innen das daraus entstehende Machtvakuum, um in den darauf folgenden sechs Monaten insgesamt 165 Häuser erfolgreich zu besetzen.(14) Erst die Wahl eines CDU-Senats um den späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Mai 1981 stoppte die Besetzungswelle. Der neue Innensenator Heinrich Lummer (CDU) ließ nicht nur Neubesetzungen konsequent räumen, die Polizei ging auch gegen bereits besetzte Häuser vor. Am 22. September 1981 erreichte die Repression einen traurigen Höhepunkt. Der Tod des Besetzers Klaus-Jürgen Rattay, der bei einer Demonstration gegen die Räumung von acht Häusern vor knüppelnden Polizist_innen über eine Straße flüchtete und dort von einem BVG-Bus zu Tode geschleift wurde, markierte das Ende jenes langen »Sommers der Anarchie«.(15) Diese Wiederherstellung der staatlichen Souveränität war jedoch nicht gleichbedeutend mit der Etablierung eines neuen gesellschaftlichen bzw. stadtpolitischen Leitbildes. Die relative Offenheit der politischen Situation, die die Hausbesetzungsbewegung mit herbeigeführt hatte, war die dritte Bedingung für ihren Erfolg. Auf der einen Seite stand die Infragestellung der bisherigen Stadterneuerungspolitik, aber auch der städtischen Sozial-, Gesundheits- und Kulturpolitik durch Hausbesetzungen, Stadtteilinitiativen, Mieter_innen, oppositionelle Planer_innen, Selbsthilfeinitiativen und Alternativprojekte. Auf der anderen Seite verband sich im CDU-geführten Senat in auch konfliktiver Weise eine an der katholischen Soziallehre geschulte Strömung um den Sozialsenator Ulf Fink, der versuchte, die Selbsthilfeinitiativen für eine Erneuerung des Sozialstaates einzubinden,(16) mit einer wirtschaftsliberalen Strömung, die auf mehr Privatinvestitionen, weniger wohlfahrtsstaatliche Daseinsvorsorge und den Rückzug des Zentralstaates aus bestimmten politischen Kompetenzen drängte, sowie mit einer konservativ-obrigkeitsstaatlichen Strömung, für die v. a. Lummer stand.(17) Gleichzeitig gewannen im Verwaltungsapparat progressive Expert_innen an Einfluss. Die 1978 als privatwirtschaftliches Unternehmen in öffentlicher Hand gegründete Internationale Bauausstellung (IBA) wurde für diese zu einem Sammelbecken. Und schließlich drängten, auch getragen von der Bewegungsdynamik, die grün-alternativen Listen in die Parlamente; vor allem im Bezirk Kreuzberg, in dem sie mit dem Stadtteilaktivisten Werner Orlowsky ab Juni 1981 den Baustadtrat stellte, war das von Bedeutung.
Auf diese institutionellen Anknüpfungspunkte, die sich aus dieser politisch relativ offenen Situation ergaben, traf eine heterogene Hausbesetzungsbewegung mit unterschiedlichen, zum Teil auch widersprüchlichen Forderungen und Zielen. Doch selbst der zentrale Konflikt, ob die Häuser als gewachsene Strukturen (conservational squatting) bzw. als Räume für alternative Lebensformen (squatting as an alternative housing strategy) letztlich auch legalisiert werden sollten oder ob sie als politischer Einsatz im Kampf gegen die gesellschaftliche Ordnung als ganze gesehen wurden (»political« squatting), konnte auf einen gemeinsamen Grundkonsens zurückgeführt werden: Autonomie, dezentrale Entscheidungsfindung und eine anti-staatliche Grundhaltung waren sowohl für die Besetzer_innen aus dem Spektrum der Alternativbewegung und für die in Pruijts missverständlicher Formulierung »politischen« Besetzer_innen (18) zentrale Prinzipien, als auch für die Stadtteilinitiativen, die gegen eine Stadtplanung von oben rebellierten und Beteiligung und Mitentscheidung der Betroffenen einforderten. Selbstverwaltung und Selbsthilfe standen als Prinzipien gegen von oben gewährte und von Expert_innen umgesetzte wohlfahrtsstaatliche Dienstleistungen.
Der CDU-Senat reagierte auf diese politische Gemengelage mit einer Strategie der selektiven Einbindung bestimmter Bewegungsteile und der repressiven Marginalisierung anderer. Diese Strategie machte zwei Konfliktlinien auf: Zum einen die Unterscheidung zwischen »nützlichen«, problemlösungsorientierten Forderungen und Initiativen einerseits und »schädlichen«, auf einen grundsätzlichen Wandel abzielenden Forderungen andererseits. In die erste Kategorie fielen die wohnungspolitischen Forderungen, die von neuen Verhandlungsgremien auf Kreuzberger Stadtteilebene sowie von der Altbau-Sektion der IBA und dem in ihrem Rahmen entwickelten Konzept der »behutsamen Stadterneuerung« aufgegriffen wurde.(19) Begünstigt wurden aber auch die Selbsthilfeinitiativen aus dem Spektrum der Alternativbewegung, die für ihre Arbeit im Sozial-, Kultur-, Gesundheits- und im Stadterneuerungsbereich staatliche Subventionen erhielten. Die andere Konfliktlinie knüpfte an den innerhalb der Hausbesetzungsbewegung von Beginn an vorhandenen und bereits angedeuteten Konflikt zwischen »Verhandler_innen« und »Nicht-Verhandler_innen« an. Hatten diese in den ersten Monaten noch zusammengearbeitet und sich gegenüber dem SPD-Übergangssenat auf ein Verhandlungsangebot geeinigt, das alle bis dahin besetzten Häuser umfassen
sollte,(20) so brach der Konflikt angesichts der zwischen Legalisierung und Repression schwankenden Politik des CDU-Senats offen aus. Die – um an die oben eingeführte Typologie anzuknüpfen – »erhaltenden«, »unternehmerischen« und die Besetzungen für neue, selbstbestimmte Wohnformen (alternative housing) richteten ihre Bemühungen tendenziell auf eine schnelle Legalisierung. Die »Besetzer_innen aus der Not heraus« (deprivational squatting) – also vor allem die arbeits- und ausbildungslosen Jugendlichen – waren hingegen kaum zur Aufnahme und Vorbereitung der komplexen, einen bestimmten Habitus und Fach-wissen erfordernden Verhandlungen in der Lage, und die »politischen« Besetzer_innen waren dazu nicht bereit. In den Jahren 1981 bis 1984 konnten die erstgenannten Gruppen so Verträge unterschiedlicher Art für ihre Häuser aushandeln, während die Häuser der letztgenannten Gruppen in den meisten Fällen geräumt wurden.(21) In Zahlen waren das 105 legalisierte und 65 geräumte Häuser.(22)
Die Legalisierung von ca. zwei Drittel der bis zum Sommer 1981 besetzten Häuser war zweifellos ein Erfolg, der nicht nur in der Absicherung der jeweiligen Wohnprojekte bestand, sondern auch in der Herausbildung einer alternativen Infrastruktur aus politischen und subkulturellen Veranstaltungsräumen, alternativ-ökonomischen Betrieben, Naturkostläden, Konsum-Kooperativen, Frauenzentren usw. Ein zweiter, mindestens ebenso wichtiger Erfolg war die Durchsetzung eines progressiven Stadterneuerungsmodells, das anstelle der zentralstaatlichen Abrissund Neubaupolitik ein Modell der dreifachen »Behutsamkeit« etablierte: baulich, indem es den Erhalt und die Instandsetzung bestehender Gebäude und städtischer Strukturen in den Mittelpunkt stellte, sozial, indem es die soziale Zusammensetzung der jeweiligen Viertel bewahren wollte, und politisch-planerisch, weil es auf einer umfassenden Beteiligung der Bewohner_innen beruhte. (23) Die Legalisierungen und das »behutsame« Vorgehen in der Stadterneuerung verwirklichten wesentliche Forderungen der Hausbesetzungsbewegung, die damit auf die Ausgestaltung der »nach-fordistischen« Stadtpolitik in den 1980er Jahren entscheidend Einfluss nahmen. Zugeständnisse »von oben« gab es allerdings nur gegen Abstriche »von unten«: Die behutsame Stadterneuerung erstreckte sich fast ausschließlich auf Kreuzberg und war im Rest der Stadt politisch-praktisches »Schmiermittel« und symbolpolitisches Feigenblatt für eine Fortführung der Abriss- und Neubau-Politik – nun unter dem Vorzeichen wohnungspolitischer Liberalisierung – sowie einer Abkehr vom »sozialen Wohnungsbau«.(24) Die Beteiligungsmechanismen wurden nicht rechtlich abgesichert, sondern bewegten sich im Rahmen von Runden Tischen oder der privatwirtschaftlich organisierten und 1987 beendeten IBA.
Nach dem Wegfall dieses Rahmens und mit der veränderten stadt- und wohnungspolitischen Situation nach dem Fall der Mauer erwiesen sich die Instrumente der behutsamen Stadterneuerung als anschlussfähig für eine neoliberalisierte Stadtpolitik: Die Dezentralisierung der Stadtpolitik und ihre Öffnung gegenüber nichtstaatlichen Akteuren mündete in einen weitgehenden Rückzug des Lokalstaats aus der wohnungspolitischen Regulierung und Förderung.(25) Die im Rahmen der behutsamen Stadterneuerung institutionalisierte Beteiligung von Mieter_innen und von Sanierungsmaßnahmen Betroffenen dienten nun dem Management der Konflikte, die durch eine Investitionen und Standortwettbewerb orientierten Stadterneuerungspolitik aufgeworfen wurden.(26) Und der progressive, auf Selbstbestimmung, demokratischer Beteiligung, sozialer Ausgewogenheit und den Abbau autoritärer Staatlichkeit abhebende Diskurs der behutsamen Stadterneuerung diente als »ideologisches ›Bindemittel‹, das widerstrebende Interessen innerhalb des bestehenden Regimes zusammenhielt«(27) und die Neoliberalisierungspolitik gegenüber den Betroffenen rechtfertigte. Kurz, im Modell der »behutsamen Stadterneuerung« waren bereits Prinzipien erkennbar, die mit der Neoliberalisierung der Stadtpolitik ab den 1990er Jahren zur Grundlage lokalstaatlichen Handelns wurden: Der Übergang vom steuernden zum aktivierenden Staat und die Privatisierung staatlicher Aufgaben – auch unter Einbeziehung von Bewegungsakteuren; die Haushaltsdisziplin als zentrale politische Norm; die Ablösung einer substanziellen Stadtplanung durch eine an ökonomischen und ästhetischen (und nicht sozialen) Gesichtspunkten orientieren Stadterneuerung; die tendenzielle Orientierung an Eigentümer_innen- und Mittelklassen-Interessen; sowie die Flankierung des staatlichen Rückzugs aus Stadterneuerung und Wohnungspolitik durch polizeiliche Repression und Kontrolle. Die Hausbesetzungsbewegung selbst zahlte für ihre Erfolge – die nur die Erfolge eines Teils der Hausbesetzungsbewegung waren – vor allem den Preis ihrer schnellen Demobilisierung. Ab 1984, dem Jahr der letzten Legalisierung und der letzten Räumung, kam sie bis zur 1989 im Ostteil der Stadt einsetzenden zweiten Welle praktisch zum Erliegen.
II.
Zeitgleich mit dem vorläufigen Ende der Hausbesetzungen in Berlin nahm in Barcelona die Geschichte einer der größten und dauerhaftesten Besetzungsbewegungen Europas ihren Anfang: Am Abend des 7. Dezember 1984 stieg eine Gruppe Jugendlicher in ein leerstehendes Haus in der Straße Torrent de l’Olla im »alternativ« geprägten Bezirk Gràcia ein. Während Unterstützer_innen aus der Nachbarschaft begannen, die Fassade lila zu streichen, richteten sich die Besetzer_innen drinnen auf ihre erste Übernachtung ein. Doch dazu sollte es nicht kommen. Der Spuk hatte nicht ganz drei Stunden gedauert, als die Bereitschaftspolizei die Jugendlichen abführte.(28)
Mit dieser Aktion betrat das movimiento okupa die politische Bühne Barcelonas. Eine kleine Gruppe jugendlicher Aktivist_innen, die sich col·lectiu squat (Besetzungskollektiv) nannte, hatte die Besetzung vorbereitet. In ihrem Manifest richteten sie sich gegen die »Konsumgesellschaft«, in der »die Lebensnotwendigkeiten ein Luxus sind, für den wir bezahlen müssen«. Die »leerstehenden Häuser sind nicht für künftige Nachbarn, sondern ein Geschäft der Spekulanten. […] Angesichts dieser stressigen Realität fehlender Lebensräume und der Verwaltung unserer Zeit durch das System« formulieren sie eine Reihe von Forderungen, u. a. nach kostenlosem Wohnen, selbstverwalteten Orten, nach öffentlichen Räumen. Sie weigerten sich, sich in das »Spiel der Stadtverwaltung und anderer Institutionen des Systems« einzugliedern, und schlossen mit der ambitionierten Ankündigung: »Wir sind hier, um in Barcelona eine Besetzungsbewegung zu gründen.«(29)
Die ersten Besetzungen in den Jahren 1984/85 gingen aus einer vom Punk und von anarchistischen Ideen beeinflussten Jugendkultur hervor. Auch sie lassen sich in die bereits beschriebene Jugendbewegung einordnen, die in ganz Westeuropa gegen ihre Perspektivlosigkeit und gegen das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum sowie nichtkommerzieller, selbstbestimmter Orte in den Städten rebellierte. Aus dem Manifest sind die Ziele und Prinzipien bereits angedeutet, die bis Ende der 1990er Jahre den kaum angefochtenen Konsens der Besetzungsbewegung darstellten: Besetzungen als Mittel zur Aneignung nicht-kommerzieller Orte, Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der Häuser, Ablehnung jeglicher Verhandlungen mit staatlichen Institutionen oder einer Legalisierung, das Selbstverständnis einer gegen die kapitalistische Mehrheitsgesellschaft gerichteten Gegenöffentlichkeit, die zwar die Unterstützung von Nachbar_innen und Stadtteilinitiativen sucht, ihre politische Perspektive aber in der Selbstemanzipation und der Zusammenarbeit mit anderen radikalen Bewegungen sieht.(30)
Das col·lectiu squat und andere Gruppen, die ihm nach dessen Auflösung 1985 in Barcelona, aber auch in anderen spanischen Städten nachfolgten, orientierten sich an den Besetzungsbewegungen der Niederlande, der BRD und Italiens. Und sie knüpften an lokale Traditionen der anarchistischen Bewegung sowie Erfahrungen der Selbstverwaltung in den Ateneus – soziokulturelle Zentren mit dem Ziel einer Wiederaneignung der Popularkultur in der Tradition der Arbeiter_innen- und anarchistischen Bewegungen – und den Stadtteilzentren der Nachbarschaftsassoziationen an.(31) Ihre radikal gegengesellschaftliche und antistaatliche Haltung wird aber erst angesichts der politischen Bedingungen verständlich, unter denen sie agierte.
Die Bewegung in Barcelona trat zu einem historisch späteren Zeitpunkt auf als andere westeuropäische Hausbesetzungsbewegungen, die Teil urbaner Bewegungen gegen die fordistische Zurichtung des städtischen Lebens waren. Diese Kämpfe führte in Barcelona (und in anderen spanischen Städten) die Nachbarschaftsbewegung, die Ende der 1960er Jahre in Initiativen gegen die katastrophale Wohnsituation in den hastig um Barcelona herum errichteten Trabantenstädten ihren Anfang nahm. Die associacions de veïns (Nachbarschaftsassoziationen), die sich im Laufe der 1970er Jahre gegen massive Repression in fast allen Städten und Stadtteilen des Großraums Barcelona gründeten, entwickelten sich aus einem Selbsthilfeansatz heraus zu Zentren der Kritik an der franquistischen Diktatur im Allgemeinen und ihrer Stadtpolitik im Besonderen.(32) Diese unterschied sich kaum von der fordistischen Stadtpolitik, die in den parlamentarischen Demokratien Westeuropas verfolgt wurde: Die Stadtplanung orientierte sich am Grundsatz der funktional nach Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und (Auto-)Verkehr aufgeteilten Stadt – wobei Wohnen und Industrie an die Stadtränder verlegt wurde und die Innenstadt der administrativen und kommerziellen Nutzung vorbehalten sein sollte. Daraus resultierte eine abriss- und neubauorientierte Wohnungspolitik, begleitet von massiver Bodenspekulation, die zu einem – größtenteils aus öffentlichen Mitteln finanzierten – »sozialen Wohnungsbau« minimalen Standards in Ausstattung
und infrastruktureller Erschließung führte. Die Stadtplanung war zentralstaatich-autoritär organisiert und von technokratischen Planer_innen ausgeführt, ohne jegliche Einbeziehung oder gar Mitbestimmung der Betroffenen.(33)
Noch zu Lebzeiten Francos, der im November 1975 starb und sein Regime kurz darauf mit ins Grab nahm, erwirkte die Nachbarschaftsbewegung mittels Unterschriftenaktionen, Massendemonstrationen, Blockaden und vereinzelten, eher symbolischen Besetzungen die Entwicklung eines neuen städtebaulichen Rahmenplans (Plan General Metropolitano), in dem wesentliche ihrer Forderungen aufgenommen wurden.(34) Oppositionelle Planer_innen, die in der Stadtverwaltung und vor allem an der Universität beschäftigt waren, wirkten an dessen Ausarbeitung mit. Die 1979 aus den ersten repräsentativ-demokratischen Kommunalwahlen hervorgegangenen Mitte-Links-Regierung entwarf daran anschließend das progressive Leitbild eines »Modell Barcelona«, das alle wichtigen gesellschaftlichen Kräfte konsensual einbinden sollte, und innerhalb dessen zentrale Bewegungsforderungen in konkrete stadtpolitische und städtebauliche Maßnahmen umgesetzt wurden. Öffentliche Parks und Plätze wurden ausgebaut, die Stadtverwaltung dezentralisiert und neu geordnet sowie neue Beteiligungsverfahren entwickelt. Neben den Forderungen und führenden Köpfen der Nachbarschaftsbewegung vereinnahmte sie auch die Nachbarschaftsassoziationen in staatlich finanzierten Stadtteilzentren. So brach die Bewegung als außerparlamentarisches Korrektiv kurz nach den Wahlen in sich zusammen. Gleichzeitig erschöpfte sich der Diskurs einer sozial gerechten Stadtentwicklung weitgehend in Symbolpolitik. Weder nahm sich die Stadtverwaltung der desolaten Zustände in den Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus an,(35) noch löste sie die Beteiligungsversprechen ein.(36) So erscheint das progressive »Modell Barcelona« im Rückblick als symbolpolitische Grundlage für eine Neoliberalisierung der Stadtpolitik, die Mitte der 1980er Jahre mit einem massiven Umstrukturierungsprogramm in der Innenstadt in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1992 begann, begleitet von den Folgen einer fast vollständigen Liberalisierung des Wohnungsmarktes auf nationalstaatlicher Ebene.(37)
So agierte auch die Besetzungsbewegung Barcelonas an der Bruchstelle zwischen einer delegitimierten fordistischen Stadtpolitik und ihrer beginnenden Neoliberalisierung. Anders als in Berlin hatte sich zum Zeitpunkt ihres Auftretens das politische Gelegenheitsfenster aber bereits geschlossen. Gleichzeitig transportierte das radikal-antagonistische Selbstverständnis des movimiento okupa die Erfahrung einer weitreichenden Vereinnahmung städtischer Bewegungen, die ein progressives Intermezzo in der Stadtpolitik erkämpft hatten, das dann mit der neoliberalen Wende ihres sozialen und demokratischen Gehaltes entledigt wurde. Die Forderungen nach einer Stadtpolitik, die öffentliche Räume, erschwingliche Wohnungen, nichtkommerzielle Orte und demokratische Mitbestimmung und Selbstverwaltung ermöglichen sollte, prallten nun am Konsens-Diskurs des »Modell Barcelona« ab, blieben aber gleichwohl virulent. Es war die Hausbesetzungsbewegung, die diese Forderungen in eine Art radikale Nischenpolitik überführte,
und damit Möglichkeitsräume für eine szenebezogene Politik der Aneignung von Orten für gelebte Alternativen öffnete.
Im Laufe der 1980er Jahre besetzten die okupas in kleinen Schritten, aber stetig diese Nische. Dabei wurden sie begünstigt von einer legalen Grauzone, die zwar nicht zur Duldung von Besetzungen führte, wie dies z. B. bei länger leerstehenden Gebäuden in den Niederlanden der Fall war, die Besetzer_innen aber vor einer strafrechtlichen Verfolgung bewahrte.(38) Im Kontext einer relativen Schwäche sozialer Bewegungen infolge ihrer institutionellen Einbeziehung durch die Stadtverwaltung begann so eine wachsende Zahl kleinerer autonomer Gruppen (39) damit, zunächst Wohnungen und Wohnhäuser nach »deutschem Modell«, ab Ende der 1980er Jahre auch größere Soziale Zentren nach italienischem Vorbild zu besetzen.(40) Im Vergleich zu den zahlreichen schnellen Räumungen waren nur wenige Besetzungen erfolgreich. Dazu gehörten das 1987 besetzte Ateneu Alternatiu iLlibertari in Sants oder die zwei Jahre später besetzte und bis heute bestehende Kasa de la Muntanya in Gràcia. Diese wurden schnell zu Zentren für andere entstehende radikale Bewegungen wie die Mobilisierung gegen die Wehrpflicht, für ökologische oder antifaschistische Gruppen.(41)
Mit den ersten länger bestehenden besetzten Zentren stellten einige Gruppen die Frage, wie sie das »Ghetto verlassen« (sortir del gueto) könnten, das sie sich einerseits selbst geschaffen hatten und in das sie andererseits vom Diskurs der Stadtverwaltung und medialen Berichterstattung gedrängt wurden. Diese nahmen sie nicht als politische Bewegungen ernst, sondern disqualifizierten die okupas zu einem »tribu urbana« (urbane Stammesgemeinschaft) und stellten sie damit an die Seite jugendlicher Kleinkrimineller oder Drogensüchtiger.(42) Es dauerte bis zur Mobilisierung gegen die strafrechtliche Kriminalisierung des Besetzens Mitte der 1990er Jahre, die ihren Höhepunkt 1996 in der öffentlichkeitswirksamen Besetzung des Cine Princesa fand, dass die mediale Kälte gegenüber der Besetzungsbewegung aufbrach und sich auch Intellektuelle und Nachbarschaftsinitiativen und z. T. linke politische Parteien auf die Besetzer_innen bezogen. Doch auch in dieser postolympischen Phase, geprägt von der abnehmenden öffentlichen Euphorie, dem übriggebliebenen städtischen Schuldenberg und weiter steigenden Mieten infolge einer privatwirtschaftlich ausgerichteten Wohnungs- und Stadterneuerungspolitik gelang es der Bewegung nicht, über ihre Existenz hinaus der neoliberalen Stadtpolitik etwas entgegenzusetzen. Erst einige Jahre später entstanden neue Besetzer_innen-Kollektive, die im Kontext einer neuen Antikriegs- und der globalisierungskritischen Bewegung sowie einer beschleunigten Stadtumstrukturierung und Immobilienspekulation die bekannten Wege der 1980er-Jahre-Bewegung verließen.(43)
III.
1984 kam in Berlin eine Hausbesetzungsbewegung zum Erliegen, die in den wenigen Jahren ihrer Existenz die Stadt unumkehrbar verändert hatte. Im gleichen Jahr besetzte in Barcelona eine erste autonome Kleingruppe leerstehende Häuser mit dem Ziel, in ihrer Stadt etwas Ähnliches zu schaffen. Dass der Beginn der einen und das Ende der anderen Bewegung nur wenige Monate auseinander lagen, ist Zufall. Der Zeitpunkt verweist bei aller Unterschiedlichkeit aber auf einen gemeinsamen Kontext: ihr Auftreten an der Bruchstelle zwischen einer entzauberten fordistischen Stadtpolitik und dem Entstehen eines neuen, neoliberalen stadtpolitischen Regimes.
Nachdem es in beiden Städten in den 1970er Jahren massive städtische Bewegungen gegen die fordistische Stadtpolitik gegeben hatte, entschied sich in den frühen 1980er Jahren, was auf das am Boden liegende Modell der »funktionalen Stadt« folgen sollte. Die Berliner Hausbesetzungsbewegung konnte wichtige Erfolge erzielen, weil sie genau an jener Bruchstelle intervenierte, weil hinter ihren Interventionen ein breites gesellschaftliches Bündnis stand, das nicht leicht zu marginalisieren oder zu unterdrücken war, und weil ihre politischen Ideen, Ziele und Handlungsformen Gemeinsamkeiten mit in anderen gesellschaftlichen Kreisen (linke Technokratie, neoliberal-konservative Kräfte) erarbeiteten Alternativen aufwies. Erfolge allerdings um den Preis einer repressiven Marginalisierung v. a. der revoltierenden Jugendlichen und der entstehenden Autonomen sowie einer schnellen Demobilisierung der Bewegung.
In Barcelona entstand die Hausbesetzungsbewegung erst, als die zentralen Weichen im Umbruch zu Neoliberalisierung der Stadt bereits gestellt waren. Die entscheidenden spätfordistischen Kämpfe gingen den Hausbesetzungen voraus, und die während der transición an die Macht gekommene Mitte-Links-Koalition war so bereits dem Druck ausgesetzt, zumindest auf einige der Forderungen nach Dezentralität, Demokratisierung und – im Bezug auf die Stadtpolitik – nach einem Ende der Politik funktionaler Entmischung und einem Ausbau öffentlicher Infrastruktur einzugehen. Mitte der 1980er Jahre begann die Stadtverwaltung jedoch, das progressive »Modell Barcelona« in ein neoliberales zu überführen. Die genau in dieser Umbruchsituation entstehende Hausbesetzungsbewegung nahm die unerfüllten Versprechen des »Modell Barcelona« auf und radikalisierte sie. Zwar sollte das movimiento okupa erst ab Mitte der 1990er Jahren zu einer der größten Besetzungsbewegung in Europa heranwachsen, für ihre Ziele, Grundsätze, Organisations- und Aktionsformen jedoch waren die Entstehungsjahre prägend und damit auch die symbolischen Ausdrucks- und Handlungsformen westeuropäischer Vorbilder, die noch im Kontext vorneoliberaler Bedingungen agierten.
Die Besetzungsbewegung in Barcelona geriet damit in die paradoxe Situation – und ist darin mit der 1989 entstehenden zweiten Welle der Berliner Hausbesetzungsbewegung vergleichbar –, unter den Bedingungen einer beginnenden Neoliberalisierung der Stadt Ziele zu artikulieren und in einer Weise zu agieren und sich zu organisieren, die ihre Wurzeln in Kämpfen gegen die fordistische Stadt hatten.
Ähnlich wie die Stadteil- und die Nachbarschaftsbewegung, wenn auch in radikalisierter Form, setzten sie Selbstverwaltung, Horizontalität und Dezentralität gegen eine zentralistisch-autoritäre Stadtplanung von oben; den Erhalt bestehender baulicher und sozialer Strukturen gegen die Abriss- und Neubaulogik der Stadterneuerung; Vielfalt und Abweichung gegen die Vereinheitlichung und funktionale Ausrichtung des städtischen Raums; sowie politische Autonomie und Konfrontation
gegen den politischen Modus korporatistischer Repräsentation und Einbindung.
In der Verwurzelung der Hausbesetzungsbewegungen in den Kämpfen am Übergang zum Neoliberalismus liegen also einerseits die Bedingungen für ihre Erfolge. Vor allem durch das Zusammenspiel institutioneller Intervention und autonomer Organisierung hat es die heterogene Berliner Hausbesetzungsbewegung vermocht, die vorhandenen Brüche in der stadtpolitischen Hegemonie zu nutzen. Andererseits weist diese Verwurzelung auch die Grenzen dafür auf, in welcher Weise heutige Besetzungsbewegungen oder andere städtische Kämpfe auf ihre Ziele und Forderungen, ihre Aktions- und Organisationsformen Bezug nehmen können: Die Prinzipien der Selbstbestimmung und -organisation, der Horizontalität und Dezentralität sind nicht in einem emanzipatorischen Sinne verwirklicht. Aber im Gegensatz zur fordistischen Stadtpolitik gehören sie zum Diskurs und in einer ökonomisierten Form zum politisch-institutionellen Repertoire der neoliberalen Regierungsweise. Sie verlieren also ihren eindeutig oppositionellen Charakter. Und die subkulturelle Szene-Bezogenheit, die antistaatliche Haltung und der damit verbundene Rückzug des movimiento okupa aus jeglicher Intervention in die staatlichen Institutionen entstanden aus einer radikalisierenden Abgrenzung von den Forderungen, die bereits vereinnahmte spätfordistische städtische Bewegungen gestellt hatten. In ihrer Negation dieser Forderungen blieben
sie einem antifordistischen Diskurs verhaftet. Zwar wuchs das movimiento okupa in den 1990er Jahren zu einer massiven Bewegung an und konnte ihre anfängliche Marginalität und Isolation durchbrechen. So gelang es ihr, Räume für alternative, nicht-kommerzielle Lebensweisen auch gegen die Repression, die ihr dabei entgegenschlug, zu behaupten – und dabei auch immer wieder Sand in das Getriebe der Stadtumstrukturierung zu streuen. Mangels eines politischen Einsatzpunktes, der die hegemoniale Stadt(erneuerungs)politik ernsthaft in Frage stellen konnte, hatte sie der fortschreitenden Neoliberalisierung der Stadt langfristig aber nichts entgegenzusetzen.
Armin Kuhn
Erschienen in >>All We ever wanted…<< Eine Kulturgeschichte europäischer Protestbewegungen der 1980er Jahre”
(1) Für einen Überblick vgl. Michael Haller (Hg.): Aussteigen oder rebellieren. Jugendliche gegen Staat und Gesellschaft, Hamburg 1981, sowie Christian Schmid: »Wir wollen die ganze Stadt! Die Achtziger Bewegung und die urbane Frage«, in: Heinz Nigg (Hg.): Wir wollen alles, und zwar subito! Die Achtziger Jugendunruhen in der Schweiz und ihre Folgen, Zürich 2001, S. 352-368.
(2) Zur Einordnung der Berliner Hausbesetzungsbewegung (sowie der Zürcher Jugend- und der Wiener Burggrabenbewegung) als spät- bzw. antifordistische Bewegung vgl. Andreas Suttner: »Beton brennt«. Hausbesetzer und Selbstverwaltung im Berlin, Wien und Zürich der 80er Jahre, Berlin 2011.
(3) Zum Ablauf der Auseinandersetzung vgl. Joseph Scheer/Jan Espert: Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Alternatives Leben oder Anarchie? Die neue Jugendrevolte am Beispiel der Berliner »Scene«, München 1982, S. 29 ff.
(4) Erhart Pfotenhauer: »Stadterneuerung – Sanierung«, in: Hartmut Häußermann (Hg.): Großstadt: Soziologische Stichworte, Opladen 2000, S. 247-257.
(5) Heide Becker/Jochen Schulz zur Wiesch: Sanierungsfolgen. Eine Wirkungsanalyse von Sanierungsmassnahmen in Berlin, Stuttgart u. a. 1982.
(6) Die in den 1970er Jahren entstandenen städtischen Kämpfe – darunter auch die Besetzungsbewegungen – sind nach der Definition von Manuel Castells den spätfordistischen »städtischen sozialen Bewegungen« zuzuordnen, die er damals überall auf der Welt entstehen sah und die sich dadurch auszeichneten, dass sie »die drei Ziele der Einforderung kollektiven Konsums, der gemeinschaftlichen Kultur und der politischen Selbstverwaltung« gleichermaßen artikulierten und verfolgten. Manuel Castells: »The City and the Grassroots. Eine transkulturelle Theorie städtischer sozialer Bewegungen«, in: An Architektur, Heft 17, 2006 [1983], S. 20.
(7) 1975 wurde der Block 118 in Charlottenburg zum Modellprojekt für eine »erhaltende und sozialverträgliche Erneuerung«, und 1977 wurden Forderungen nach ähnlichen Maßnahmen im städtebaulichen Wettbewerb »Strategien für Kreuzberg« laut, vgl. Matthias Bernt: Rübergeklappt! Die »Behutsame Stadterneuerung« im Berlin der 90er Jahre, Berlin 2003, S. 42.
(8) 1978 bzw. 1980 sabotierten Anwohner_innen Umbaumaßnahmen am Oranien- bzw. am Mariannenplatz, vgl. Bernd Laurisch: Kein Abriß unter dieser Nummer. 2 Jahre Instandbesetzung in der Cuvrystraße in Berlin-Kreuzberg, Gießen 1981, S. 29. 1977 besetzten Bürger_innen-Initiativen die Alte Feuerwache in der Reichenberger Straße und stoppten damit den geplanten Abriss, vgl. Renate Mulhak: »Der Instandbesetzungskonflikt in Berlin«, in: Peter Grottian/Willfried Nelles (Hg.): Großstadt und neue soziale Bewegungen, Basel u. a. 1983, S. 213 f.
(9) Stefan Aust/Sabine Rosenbladt: Hausbesetzer. Wofür sie kämpfen, wie sie leben und wie sie leben wollen, Hamburg 1981, S. 37.
(10 Karl M. Michel/Tilman Spengler (Hg.): Kursbuch 65. Der große Bruch – Revolte 81, Berlin 1981.
(11) Ich spreche hier von der ersten großen Hausbesetzungswelle, weil es bereits Anfang der 1970er Jahre erste Besetzungen gegeben hatte, darunter das noch heute bestehende Georg-von-Rauch-Haus oder die Besetzungen, mit denen das ebenfalls noch existierende Thommy-Weißbecker-Haus erkämpft wurde.
(12) Wolfgang Kraushaar: Autonomie oder Getto? Kontroversen über die Alternativbewegung, Frankfurt/M. 1978.
(13) Ich greife hier auf eine von Hans Pruijt entworfene Typologie von Hausbesetzungen zurück, vgl. Hans Pruijt: »Okupar in Europa«, in: Ramón Adell Argilés/Miguel Martínez López (Hg.): ¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales, Madrid 2004, S. 37.
(14) Ruud Koopmans: Democracy from below. New social movements and the political system in West Germany, Boulder, Col. u. a. 1995, S. 174.
(15) AG Grauwacke: Autonome in Bewegung. Aus den ersten 23 Jahren, 4. Aufl., Berlin 2008, S. 58 ff.
(16) Zeugnis seiner Bemühungen ist der von ihm selbst herausgegebene Band: Ulf Fink (Hg.): Keine Angst vor Alternativen. Ein Minister wagt sich in die Szene, Freiburg i. Br. 1983.
(17) Zur Modernisierung des politischen Konservatismus im Allgemeinen und der bundesdeutschen CDU im Besonderen Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre vgl. Thomas Kreuder/Hanno Loewy (Hg.): Konservatismus in der Strukturkrise, Frankfurt/M. 1987, dabei insbesondere den Aufsatz von Peter J. Grafe: »Skizze über die ›moderne‹ CDU«, S. 285-300.
(18) Die Bezeichnung ist missverständlich, weil auch alle anderen genannten Typen von Besetzungen einen dezidiert politischen Charakter hatten. Da jede andere Bezeichnung aber ebenso vieldeutig und vereinseitigend wäre, halte ich an der Bezeichnung »politische« Besetzungen in Pruijts Sinne fest.
(19) Bernt, S. 52 ff.
(20) Scheer/Espert, S. 55.
(21) Eine detaillierte Darstellung findet sich bei Andrej Holm/Armin Kuhn: »Squatting and Urban Renewal in Berlin. The interaction of squatter movements and strategies of urban restructuring«, in: International Journal of Urban and Regional Research, 35. Jg., H. 3, 2011, S. 644-658.
(22) Koopmans, S. 178.
(23) Andrej Holm/Armin Kuhn: »Häuserkampf und Stadterneuerung«, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 3/2010, S. 110.
(24) Renate Borst: »Mietenpolitik und Stadtpolitik. Thesen«, in: dies. u. a. (Hg.): Mietropolis, Mietpreisbindung und Stadtpolitik, Berlin 1986, S. 153.
(25) Bernt, S. 237.
(26) Ebd., S. 126 ff. sowie Hartmut Häußermann/Andrej Holm/Daniela Zunzer: Stadterneuerung in der Berliner Republik. Modernisierung in Berlin-Prenzlauer Berg, Opladen 2002, S. 221 und Andrej Holm: Die Restrukturierung des Raumes. Stadterneuerung der 90er Jahre in Ostberlin: Interessen und Machtverhältnisse, Bielefeld 2006, S. 315 ff.
(27) Bernt, S. 253.
(28) Francisco de Paula Fernández Gómez: Okupació a Catalunya 1984-2009, Barcelona 2010, S. 58f.
(29) Ebd., S. 63.
(30) Miguel Martínez López: Okupaciones de viviendas y de centros sociales. Autogestión, contracultura y conflictos urbanos, Barcelona 2002, S. 180 ff. Gegenüber der Konzentration auf die gegenkulturelle Selbstbestimmung rückten die im Legitimationsdiskurs der Besetzungsbewegung präsente Kritik an Wohnraumspekulation und Stadtumstrukturierung in den Hintergrund, vgl. Iván Miró i Ácedo: »Dibujando nuevas, rápidas figuras«, in: Pedro Ibarra/Elena Grau (Hg.): La red en la ciudad, Barcelona 2008, S. 90.
(31) Martínez López, S. 147 ff.
(32) Ricard Martínez i Muntada: »El moviment veïnal en el tardofranquisme i la transició: conflicte, identitat obrera i valors alternatius«, in: Enric Prat (Hg.): Els moviments socials a la Catalunya contemporánia, 2004, S. 71-91.
(33) Jürgen Bähr/Paul Gans: »Barcelona. Entwicklungsphasen und gegenwärtige Struktur der katalonischen Metropole«, in: Geographische Rundschau, 38. Jg., H. 1, 1986, S. 9-18.
(34) Dazu gehörten v. a. die Abkehr vom Leitbild des territorialen Wachstum und der funktionalen Aufteilung der Stadt sowie die Aufnahme konkreter Aktionsprogramme gegen die mangelhafte öffentliche Infrastruktur, vgl. Gerhard Held: »Barcelona, doppelte Stadt«, in: Ursula von Petz/Klaus M. Schmals (Hg): Metropole, Weltstadt, Global City: Neue Formen der Urbanisierung, Dortmund 1992, S. 260.
(35) Thomas Lussi: »Stadterneuerung in Barcelona«, in: Harald Bodenschatz u. a. (Hg.): Stadterneuerung im Umbruch, Berlin 1994, S. 167.
(36) Mari Paz Balibrea: »Urbanism, culture and the post-industrial city: challenging the ›Barcelona Model‹«, in: Tim Marshall (Hg.): Transforming Barcelona, London, New York 2004, S. 209.
(37) Die Neoliberalisierung der Stadt Barcelona verlief ungleich schneller als die vergleichbare Entwicklung in Berlin, nicht nur infolge der Olympischen Spiele, sondern auch eines die gesamte spanische Wirtschaft der 1990er und 2000er Jahre prägenden Immobilienbooms. Davon abgesehen, basierte die Stadtpolitik auf den gleichen Prinzipien, wie ich sie oben für das Berlin seit den 1990er Jahren erläutert habe. Und auch die Stadtverwaltung Barcelonas konnte auf den Fundus eines progressiven Stadterneuerungsmodells zurückgreifen, dessen Diskurs und Instrumente für eine Neoliberalisierung anschlussfähig waren. Vgl. Manuel Delgado: La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del »modelo Barcelona«, Madrid 2007.
(38) Jaume Asens: »La criminalización del movimiento okupa«, in: Asamblea de Okupas de Terrassa (Hg.): Okupacón, Represión y Movimientos Sociales, Madrid 2000, S. 57-80.
(39) »Autonom« sollte hier nicht als politische Einordnung, sondern im wörtlichen Sinne, d. h. selbstbestimmt und unabhängig von anderen politischen Gruppen und Institutionen verstanden werden. Dennoch gibt es in Zielen, Organisationsweise und subkulturellem Stil zahlreiche Ähnlichkeiten mit den Autonomen in der BRD.
(40) Vgl. Tomás Herreros i Sala: »Movimiento de las okupaciones y movimientos sociales: elementos de análisis para el caso de Cataluña«, in: Ramón Adell Argilés/Miguel Martínez López (Hg.): ¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales, Madrid 2004, S. 138.
(41) Ders.: »El moviment de les okupacions – La revifalla dels moviments socials«, in: Eric Prat (Hg.): Els moviments socials a la Catalunya contemporánia, Barcelona 2004, S. 217-240.
(42) Fernández Gómez, S. 22.
(43) Dazu gehören die in der Assemblea del Barri de Sants versammelten Projekte sowie die Sozialen Zentren Miles de Viviendas oder Can Masdeu. Und der Kampf um den sogenannten Forat de la Vergonya oder die Nachbarschaftsinitiative La Hostia gegen Aufwertung und Verdrängung im Stadtteil Barceloneta sind konkrete Beispiele einer gemeinsamen Organisierung von Besetzer_innen und Anwohner_innen. Vgl. Miro i Acedo, S. 81-94.